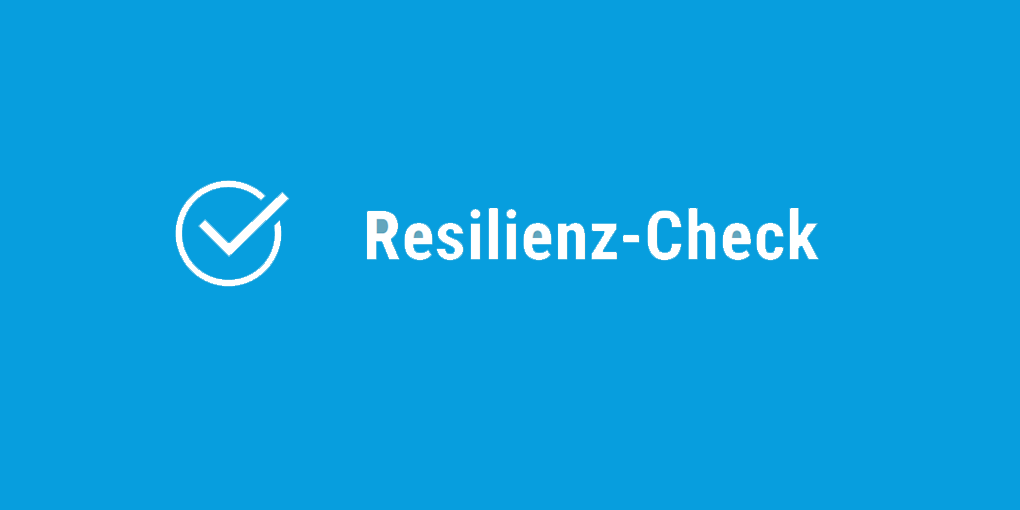
Resilienz-Check
- Projektteam:
Michaela Evers-Wölk, Roland Nolte, Ingo Kollosche, Nona Bledow, Maren Eickhoff, Carolin Kahlisch, André Uhl
(mit jeweils weiterer fachlicher infrastruktursystembezogener Unterstützung)
- Themenfeld:
- Starttermin:
2024
- Endtermin:
2028
sprungmarken_marker_4357
Hintergrund, Zielsetzung und Ergebnisse
Aufbauend auf den Ergebnissen des Resilienz-Radars, die im Foresight-Report veröffentlicht werden, wird jährlich ein infrastrukturbezogenes Fokusthema ausgewählt, das in der Vertiefungsphase des erweiterten Foresight-Prozesses einem Resilienz-Check unterzogen wird.
Der Resilienz-Check konzentriert sich auf Themenfelder, die im wissenschaftlichen Diskurs als besonders vielversprechend für die Stärkung der Resilienz gelten. Auf dieser Basis werden Entwicklungspotenziale analysiert, systemische Risiken in Zukunftsszenarien identifiziert und daraus tragfähige Strategien zur Stärkung der Resilienz abgeleitet.
Die Auswahl des Fokusthemas für die vertiefende Analyse im Resilienz-Check erfolgt durch die Berichterstattergruppe TA. Dadurch wird sichergestellt, dass nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch besonders relevante Herausforderungen adressiert werden.
Vorläufige Ergebnisse des Resilienz-Checks werden jeweils im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung „TA im Dialog“ im Deutschen Bundestag vorgestellt und mit Abgeordneten sowie weiteren Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. Die Rückmeldungen aus diesem dialogischen Austausch fließen in die finale Ausarbeitung des Resilienz-Dossiers ein und stärken dessen Praxis- und Politikrelevanz.
Methodisches Vorgehen
Im Zuge eines strukturierten Analyse- und Szenarioprozesses werden Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Administration sowie der Zivilgesellschaft kooperativ eingebunden. Die Durchführung des Resilienz-Checks dauert neun Monate und umfasst die folgenden drei Arbeitsschritte:
1. Systembild
Zunächst werden die relevanten Einflussfaktoren für die Fokusthemen des Infrastruktursystems bestimmt und strukturiert. Hierzu werden u.a. moderierte digitale „Round Tables“ mit externen Expert/innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Administration durchgeführt. Als Ergebnis liegt ein dynamisches Systembild in visualisierter Form vor.
2. Szenariobildung
Anschließend werden plausible Zukunftsszenarien entwickelt und Schwachstellen aufgezeigt, die sich vor dem Hintergrund systemischer Risiken ergeben. Dazu werden auf Grundlage von identifizierten Schlüsselfaktoren Zukunftsprojektionen entwickelt und Rohszenarien abgeleitet. Im Anschluss werden u.a. im Rahmen eines Expert/innenworkshops die Folgen von Störereignissen durchgespielt. Der Arbeitsschritt schließt mit einer prägnanten Beschreibung der Zukunftsszenarien ab.
3. Policy-Analyse
Die Zukunftsszenarien werden abschließend systematisch ausgewertet, dabei werden sowohl Vulnerabilitäten als auch Möglichkeiten für eine Stärkung der Resilienz des Infrastruktursystems identifiziert. In einem strukturierten Prozess werden Gestaltungsoptionen, Handlungsansätze und Strategieelemente herausgearbeitet. Hierfür wird u.a. eine moderierte Veranstaltung durchgeführt, die neben Wissenschaftler/innen auch fachliche Expert/innen aus der jeweiligen Versorgungspraxis des Infrastruktursystems und ausgewählte Vertreter/innen der Bürgerschaft in thematischen Arbeitsgruppen zusammenführt.
Resilienz-Check 2024/25: Wassermanagement in der Landwirtschaft
Im Mittelpunkt des diesjährigen Resilienz-Checks steht das Wassermanagement in der Landwirtschaft. Angesichts des Klimawandels, zunehmender Trockenheit und ungleich verteilter Niederschläge in Deutschland muss die Landwirtschaft neue Wege finden, um mit den veränderten Bedingungen umzugehen. Effiziente Bewässerungstechniken, neue Bewirtschaftungsformen und geschlossene Produktionssysteme bieten vielversprechende Ansätze, um Wasserressourcen besser zu nutzen und die Landwirtschaft resilienter zu machen.
Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung "TA im Dialog: Zukunftsfähiges Wassermanagement in der Landwirtschaft" am 27. November 2024 im Paul-Löbe-Haus wurden die Zwischenergebnisse des Resilienz-Check 2024 vorgestellt und mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, Mitgliedern des Deutschen Bundestages und weiteren gesellschaftlichen Akteuren diskutiert.

Öffentliches Fachgespräch im Bundestag am 27. November 2024
NachschauenResilienz-Dossier 2025: Wassermanagement in der Landwirtschaft
Das am 20. Oktober 2025 auf unserer Foresight-Plattform veröffentlichte Resilienz-Dossier präsentiert die Ergebnisse des Resilienz-Checks zum Fokusthema „Wassermanagement in der Landwirtschaft“. Das Thema wurde von der Berichterstattergruppe für Technikfolgenabschätzung auf Basis der Analysen des Resilienz-Radars 2023/2024 ausgewählt. Dessen Ergebnisse zum Infrastruktursystem Landwirtschaft und Ernährung haben gezeigt, dass in Deutschland eine hohe Gefährdungslage durch systemische Risiken wie globale Erwärmung und zunehmende Wetterextreme besteht. Die Landwirtschaft wird daher neue Wege finden müssen, um mit den veränderten Bedingungen umzugehen.
Effiziente Bewässerungstechniken, neue Bewirtschaftungsformen sowie geschlossene Produktionssysteme gelten als strategische Themenfelder mit besonderem Potenzial zur Stärkung der Resilienz in der Landwirtschaft. Sie bieten vielversprechende Ansätze, um Wasserressourcen besser zu nutzen und landwirtschaftliche Systeme widerstandsfähiger gegenüber negativen Umwelteinflüssen zu machen. Vor diesem Hintergrund richtet der Resilienz-Check 2024/2025 seinen analytischen Fokus gezielt auf diese drei strategischen Themenfelder, um deren Resilienzpotenziale differenziert zu erfassen und zu bewerten.

Ergebnisse aus dem Resilienz-Check.2024/25.
Zur Foresight-PlattformResilienz-Check 2025/26: Cybersicherheit im Forschungsprozess
Im Mittelpunkt des diesjährigen Resilienz-Checks steht die Cybersicherheit im Forschungsprozess. Digitalisierung und Vernetzung von Forschungseinrichtungen – wie im Trendcluster Digitalisierung der Forschungswelten veranschaulicht – erweitert die Angriffsfläche für Cyberbedrohungen erheblich. Datenlecks, gezielte Cyberangriffe oder Spionage gefährden nicht nur vertrauliche Forschungsprojekte, sondern auch die Integrität wissenschaftlicher Erkenntnisse. Um die Resilienz des Forschungssystems zu stärken, sind gezielte Strategien zur Cybersicherheit unerlässlich.
Im Fokus stehen strategische Themenfelder zum Schutz sensibler Forschungsdaten, insbesondere deren sichere Speicherung, Verarbeitung und Übertragung auch bei internationaler Kooperation. Zudem werden innovative Ansätze zur Stärkung der Cybersicherheitskompetenzen in Forschungseinrichtungen berücksichtigt.
Das Ziel des Resilienz-Checks auf Grundlage dieses Fokusthemas ist es, wissenschaftlich-technologische Innovationsansätze im Zusammenhang mit Cybersicherheit zu analysieren, die die Resilienz von Forschungseinrichtungen stärken. Zudem werden mögliche neue Risiken identifiziert, die mit den jeweiligen Ansätzen verbunden sein könnten, und resilienzorientierte Strategien entwickelt, um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen.
