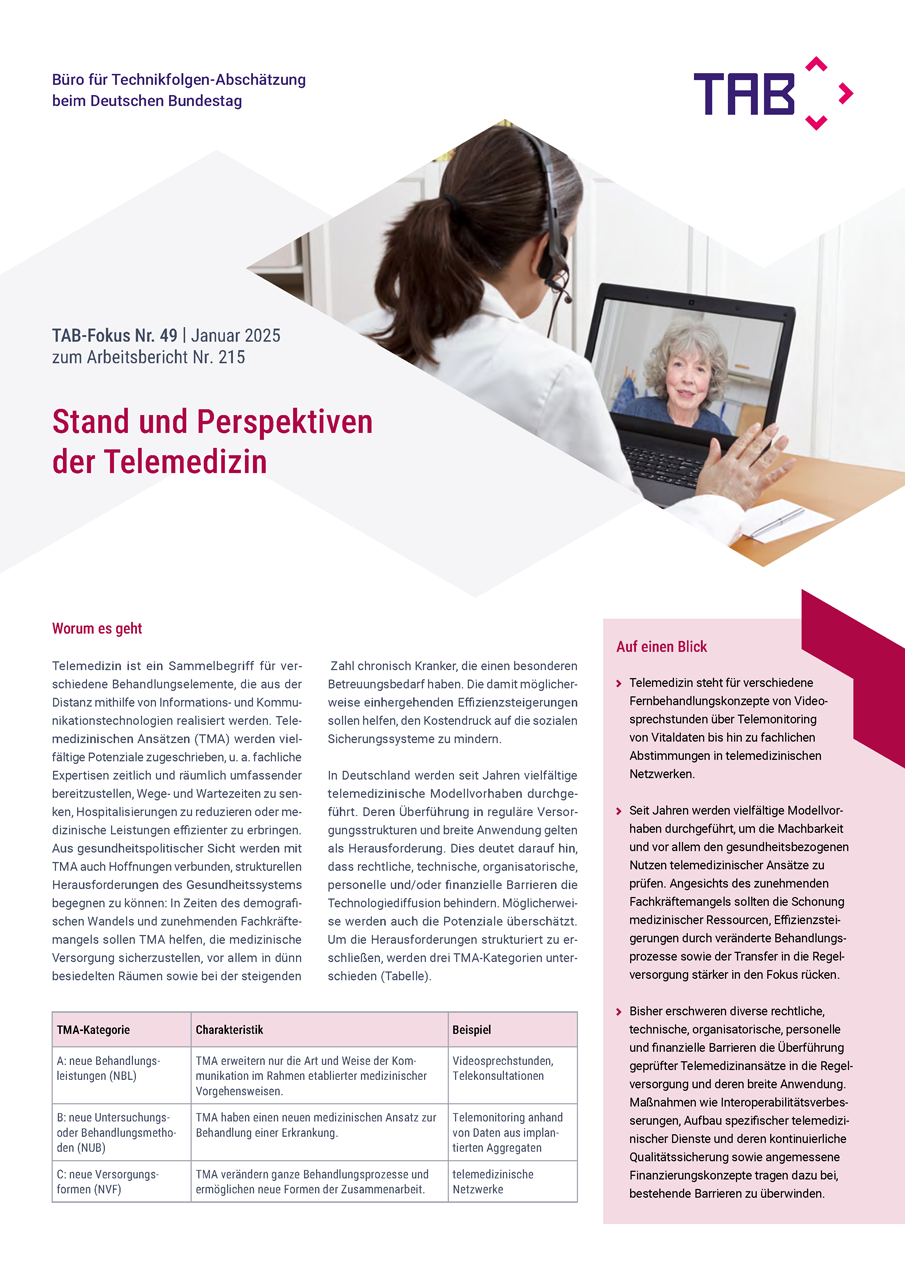Stand und Perspektiven der Telemedizin
- Projektteam:
Katrin Gerlinger (Projektleitung); Michaela Evers-Wölk
- Themenfeld:
- Themeninitiative:
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
- Analyseansatz:
TA-Projekt
- Starttermin:
2019
- Endtermin:
2025
Der Endbericht zum TA-Projekt wurde vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am 29. Januar 2025 abgenommen.
Stand und Perspektiven der Telemedizin
Auf einen Blick
- Telemedizin steht für verschiedene Fernbehandlungskonzepte von Videosprechstunden über Telemonitoring von Vitaldaten bis hin zu fachlichen Abstimmungen in telemedizinischen Netzwerken.
- Seit Jahren werden vielfältige Modellvorhaben durchgeführt, um die Machbarkeit und vor allem den gesundheitsbezogenen Nutzen telemedizinischer Ansätze zu prüfen. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels sollten die Schonung medizinischer Ressourcen, Effizienzsteigerungen durch veränderte Behandlungsprozesse sowie der Transfer in die Regelversorgung stärker in den Fokus rücken.
- Bisher erschweren diverse rechtliche, technische, organisatorische, personelle und finanzielle Barrieren die Überführung geprüfter Telemedizinansätze in die Regelversorgung und deren breite Anwendung. Maßnahmen wie Interoperabilitätsverbesserungen, Aufbau spezifischer telemedizinischer Dienste und deren kontinuierliche Qualitätssicherung sowie angemessene Finanzierungskonzepte tragen dazu bei, bestehende Barrieren zu überwinden.
sprungmarken_marker_4814
Worum es geht
Telemedizin ist ein Sammelbegriff für verschiedene Behandlungselemente, die aus der Distanz mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien realisiert werden. Telemedizinischen Ansätzen (TMA) werden vielfältige Potenziale zugeschrieben, u. a. fachliche Expertisen zeitlich und räumlich umfassender bereitzustellen, Wege- und Wartezeiten zu senken, Hospitalisierungen zu reduzieren oder medizinische Leistungen effizienter zu erbringen. Aus gesundheitspolitischer Sicht werden mit TMA auch Hoffnungen verbunden, strukturellen Herausforderungen des Gesundheitssystems begegnen zu können: In Zeiten des demografischen Wandels und zunehmenden Fachkräftemangels sollen TMA helfen, die medizinische Versorgung sicherzustellen, vor allem in dünn besiedelten Räumen sowie bei der steigenden Zahl chronisch Kranker, die einen besonderen Betreuungsbedarf haben. Die damit möglicherweise einhergehenden Effizienzsteigerungen sollen helfen, den Kostendruck auf die sozialen Sicherungssysteme zu mindern.
In Deutschland werden seit Jahren vielfältige telemedizinische Modellvorhaben durchgeführt. Deren Überführung in reguläre Versorgungsstrukturen und breite Anwendung gelten als Herausforderung. Dies deutet darauf hin, dass rechtliche, technische, organisatorische, personelle und/oder finanzielle Barrieren die Technologiediffusion behindern. Möglicherweise werden auch die Potenziale überschätzt. Um die Herausforderungen strukturiert zu erschließen, werden drei TMA-Kategorien unterschieden (Tabelle).
| TMA-Kategorie | Charakteristik | Beispiel |
|---|---|---|
| A: neue Behandlungsleistungen (NBL) | TMA erweitern nur die Art und Weise der Kommunikation im Rahmen etablierter medizinischer Vorgehensweisen. | Videosprechstunden, Telekonsultationen |
| B: neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden (NUB) | TMA haben einen neuen medizinischen Ansatz zur Behandlung einer Erkrankung. | Telemonitoring anhand von Daten aus implantierten Aggregaten |
| C: neue Versorgungsformen (NVF) | TMA verändern ganze Behandlungsprozesse und ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit. | telemedizinische Netzwerke |
Rechtsstruktur der telemedizinischen Leistungserbringung
Ärzt/innen haben bei der (tele)medizinischen Behandlung eine Schlüsselposition. Rechtlich schulden sie ihren Patient/innen eine sorgfältige Vorgehensweise nach anerkannten fachlichen Standards. Telemedizinische Ansätze müssen in der Aus- und Weiterbildung sowie in zahlreichen Behandlungsleitlinien verankert werden, um das notwendige fachliche Fundament für die Anwendung und die sorgfältige Vorgehensweise zu legen.
Patient/innen sind bei Erhalt (tele)medizinischer Leistungen zur Vergütung verpflichtet, die zumeist von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abgedeckt wird. Welche (tele)medizinischen Leistungen die GKV erstattet, wie sie zu erbringen sind und vergütet werden, wird im Sozialgesetzbuch V grundsätzlich definiert und in verschiedenen Richtlinien, Vereinbarungen, Listen und Katalogen konkretisiert. Diese werden von verschiedenen Organen der Selbstverwaltung erarbeitet und durch kollektiv vereinbarte Versorgungsverträge rechtswirksam. Sie definieren die Regelversorgung der GKV, die im ambulanten und im stationären Bereich jeweils eigenständig organisiert, realisiert und vergütet wird. Zur Förderung (tele)medizinischer Innovationen können einzelne Krankenkassen darüber hinaus mit vielfältigen Leistungserbringern selektive Versorgungsverträge abschließen und u. a. über die Regelversorgung hinausgehende telemedizinische Leistungen oder die Durchführung entsprechender Modellvorhaben vereinbaren. Solche Zusatzangebote stehen nicht allen Versicherten offen.
Die Aufnahme unterschiedlicher TMA in die administrativen Strukturen des ambulanten und/oder des stationären Bereichs sind eine notwendige Bedingung, aber noch kein Garant für deren Anwendung. Beteiligte Ärzt/innen und medizinische Fachkräfte müssen die TMA in ihre Arbeitsabläufe integrieren können, damit einen medizinischen Mehrwert verbinden und angemessen vergütet werden.
Technische Aspekte
Im Minimalfall benötigen am jeweiligen telemedizinischen Prozess Beteiligte (Ärzt/innen, medizinische Fachkräfte, Patient/innen) ein Endgerät, eine zuverlässige Netzanbindung, spezifische Kommunikationsdienste und entsprechende Anwendungskompetenzen. Besondere Potenziale haben TMA, bei denen Beteiligte nicht nur audiovisuell oder verbal kommunizieren, sondern auch behandlungsrelevante Daten erhoben, geteilt und analysiert werden, um medizinische Sachverhalte aus der Distanz spezifischer beurteilen zu können. Geräte und Software, mit denen Daten zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten erhoben und analysiert werden, sind zertifizierungspflichtige Medizinprodukte. Etliche werden nur in medizinischen Einrichtungen eingesetzt (z.B. CT-, MRT-Geräte). Die erhobenen Daten werden mittels spezieller Informationssysteme analysiert und gespeichert. Diese Systeme sind meist einrichtungsspezifische, weitgehend geschlossene Softwareinsellösungen mit heterogenen Datenstrukturen, die höchsten Schutzstandards unterliegen. Zunehmend gibt es auch Geräte und Apps, mit denen Patient/innen behandlungsrelevante Vitaldaten selbst erheben und an spezielle Plattformen übermitteln, auf die behandelnde Ärzt/innen selektiv zugreifen können.
Seit Jahren wird sowohl national als auch international an einheitlichen medizinischen Spezifikationen, Standards, Schnittstellen und Profilen zum Datenmanagement gearbeitet. Mit dem Auf- und Ausbau der Telematikinfrastruktur (TI) und ersten telemedizinisch relevanten Services (z.B. elektronische Rezepte, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Patientenakten) wird das technische Fundament für TMA besser. Dennoch sind auch zukünftig erhebliche Anstrengungen zur Digitalisierung von Versorgungsprozessen und zur Verbesserung der Interoperabilität nötig, um TMA effizient einsetzen und einen Mehrwert erzielen zu können.
Videosprechstunden/Telekonsultationen in der Schweiz und in Deutschland
In der Schweiz wurde bereits um die Jahrtausendwende eine Teleklinik mit einem ausschließlich auf Telekonsultationen basierenden Behandlungskonzept zugelassen. Zu diesem Konzept gehören
- eine strukturierte Ersteinschätzung der Ratsuchenden,
- eine spezielle Fortbildung mit Zertifizierung für Teleärzt/innen,
- Guidelines zur Gesprächsführung und einer engmaschigen Betreuung,
- ein spezifisches Informations- und Qualitätsmanagementsystem zur Dokumentation, Nachverfolgung des Krankheitsverlaufs und Überwachung definierter Qualitätskennziffern sowie
- ein landesweites Netz kooperierender Einrichtungen, die ggf. notwendige Untersuchungen und Behandlungen vor Ort übernehmen.
Inzwischen ist die schweizerische Teleklinik mit 140 Teleärzt/innen, die landesweit rund um die Uhr Patient/innen per Telefon, Video und Chat betreuen, die größte in Europa. Etwa 50 % der Anrufer/innen können vollständig telemedizinisch betreut werden. Die anderen werden vorzugsweise in Kooperation mit den Netzwerkeinrichtungen behandelt oder an den Rettungsdienst vermittelt.
In Deutschland dürfen ambulant tätige Ärzt/innen seit 2017 neben der Präsenzbehandlung auch in begrenztem Umfang Telekonsultationen durchführen und mit der GKV abrechnen. Eine Schulung ist nicht erforderlich. Bisher gibt es nur in wenigen Behandlungsleitlinien Hinweise zum Einsatz von Telekonsultationen. Obwohl viele Ärzt/innen während der Pandemie Anwendungserfahrungen gesammelt haben, werden Telekonsultationen derzeit nur von Psychotherapeut/innen in größerem Umfang eingesetzt (von ca. 50%). Bei anderen Fachgruppen ist dieser Anteil viel geringer (8 % der Hausärzt/innen, andere Fachärzt/innen noch weniger). Reine Telekliniken erhalten bisher keine Zulassung zur GKV-Regelversorgung. Da nur wenige Ärzt/innen Telekonsultationen anbieten, sind Onlineportale für die Vermittlung von ärztlichen Angeboten und patientenseitigen Nachfragen relevant. Nachdem erste kommerzielle Anbieter ihre Arztportale entsprechend ausgebaut haben, ziehen Kassenärztliche Vereinigungen inzwischen nach, vor allem zur Entlastung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes.
Befürworter von Teleklinikkonzepten betonen die dadurch möglichen flexibleren Arbeitsmodelle, sinkende Wege- und Wartezeiten sowie eine Entlastung von Akut- und Rettungsstellen. In Deutschland stehen Kassenärzt/innen und deren Vereinigungen dem Konzept eher kritisch gegenüber. Sie zeigen keine Bereitschaft, zukünftig mit Telekliniken zu kooperieren, um Behandlungen ggf. vor Ort fortzuführen. Dadurch wäre die Behandlungssicherheit in vielen Fällen nicht gegeben. Aus Sicht der Kassenärzt/innen würden Telekliniken zudem die etablierte Bedarfsplanung und Leistungsvergütung gefährden (derzeit werden u.a. betreuungsintensive Behandlungsfälle teils über Bagatellfälle querfinanziert).
Telemonitoring
Beim Telemonitoring übermitteln Patient/innen regelmäßig definierte Vitaldaten an spezielle Plattformen, auf denen diese gesammelt und medizinisch überwacht werden, um Verschlechterungen des Gesundheitszustandes aus der Distanz erkennen und zeitnah gegensteuern zu können. Erste Konzepte wurden um die Jahrtausendwende für Herzinsuffizienzpatient/innen entwickelt, die spezielle datensendende Herzschrittmacher trugen (Typ-1-Monitoring). Im GKV-Rahmen wurde dies 2015 als neue Behandlungsmethode eingestuft und ein aufwendiges Bewertungsverfahren durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) eingeleitet. Zudem wurden Telemonitoringkonzepte entwickelt, die bei Herzinsuffizienz ohnehin regelmäßig zu kontrollierende Vitaldaten (u.a. Gewicht, Blutdruck, Wohlbefinden) überwachen (Typ-2-Monitoring). In etlichen Ländern wurden Studien durchgeführt, in denen Patient/innen Messgeräte und spezielle Apps mit unterschiedlichen Funktionalitäten (u.a. zum Datenmanagement, zur persönlichen Kontrolle und Kommunikation mit Studienzentren sowie mit Informationsmaterial zum Krankheitsverlauf) erhielten. Heterogene Studiensettings und -ergebnisse erschwerten die Bewertung. Erst Ende 2020 wurde ein geringfügiger Nutzen beider Konzepte bei einer kleinen Patientengruppe anerkannt, die Vorgehensweise spezifiziert sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen und Vergütung festgelegt. Seit April 2022 können Patient/innen dieser kleinen Gruppe regulär fernüberwacht und entsprechende Leistungen abgerechnet werden. Dafür müssen kardiologisch geleitete Telemonitoringzentren (TMZ) eingerichtet und zertifiziert werden. Sie tragen die Verantwortung für die Vorgehensweise, können jedoch einige Leistungen delegieren (u.a. Patientenausstattung und -betreuung, Plattformbetrieb).
Am bisherigen Vorgehen gibt es einige Kritikpunkte. Typ-2-Monitoringonzepte seien keine neue Behandlungsmethode, das aufwendige Bewertungsverfahren sei unangemessen. Ein schnelleres Verfahren sei nötig, um Telemonitoring zügig auf weitere Behandlungskontexte ausweiten zu können. Das Fast-Track-Verfahren für digitale Gesundheitsanwendungen biete sich an, da ohnehin spezielle Apps eingesetzt werden. Der TMZ-basierte Ansatz ist ressourcenintensiv, mit erheblichem Abstimmungsaufwand zwischen TMZ, Patient/innen und primär behandelnden Ärzt/innen sowie mit gewissen Haftungsunsicherheiten verbunden. Zwar benötigen TMZ eine Zulassung, nicht aber die Dienstleister mit ihren Apps und Plattformen. Unklar ist, ob alle Aktivitäten ausreichend vergütet werden.
Telemedizinische Netzwerke
Um die Jahrtausendwende entstanden in Deutschland erste regionale Teleradiologienetzwerke mit einem Zentrum, an das kooperierende Kliniken radiologische Aufnahmen über ein gesichertes Kommunikationsnetz übermitteln und Befunde zeitnah zurückbekommen. In anderen telemedizinischen Netzwerken leiten erfahrene Fachärzt/innen in spezialisierten Zentren Behandlungsteams in kooperierenden Einrichtungen gezielt an (z.B. in Schlaganfall- oder intensivmedizinischen Netzwerken, bei Telenotarztkonzepten). Die Zentren richten Telearbeitsplätze ein und sichern Telekonsildienste durch Fachärzt/innen ab. Kooperierende Einrichtungen werden spezifisch ausgestattet, um Expert/innen zur Behandlung hinzuziehen, Diagnostik und spezielle Behandlungen vor Ort durchführen sowie Daten und Informationen übermitteln zu können. Regelmäßige Schulungen, Zertifizierungen, Guidelines zur Vorgehensweise und Maßnahmen zur Qualitätssicherung (u.a. Fallregistrierungen) sind Bestandteile der Konzepte. Derartige Netzwerke können etablierte medizinische Versorgungsformen umfassender verändern. Dafür muss die Digitalisierung medizinischer Prozessabläufe intensiviert werden sowie entstehende Behandlungsdaten in stärkerem Maße standardisiert und einrichtungsübergreifend genutzt werden können. Neben den damit verbundenen technischen Herausforderungen sind verschiedene organisatorische, administrative, finanzielle und (haftungs)rechtliche Aspekte zu klären.
Es scheint plausibel, dass mittels solcher Netzwerke besondere medizinische Fachexpertise auch in strukturschwache Regionen gebracht werden kann. Allerdings müssen kooperierende Einrichtungen technisch und personell in der Lage sein, die jeweiligen Empfehlungen umzusetzen und die Behandlungen durchzuführen. Die dafür erforderlichen Ärzt/innen, Rettungs- und Pflegekräfte sind bereits heute knapp und teilweise überlastet. Es ist kaum zu erwarten, dass sie durch telekonsiliarische Anfragen und telemedizinisch zugeschaltete Expert/innen entlastet werden.
Televisite am Krankenbett

Arbeitsplatz im telemedizinischen Zentrum

Handlungsoptionen
Handlungsoptionen ergeben sich sowohl übergreifend für alle TMA als auch spezifisch:
- Technische Aspekte: Zum einen sollte der Ausbau von Breitband- und Mobilfunknetzen in medizinisch unterversorgten Regionen priorisiert und die Anbindung medizinischer Einrichtungen vorangetrieben werden. Zum anderen bleiben die Digitalisierung medizinischer Versorgungsprozesse, die Entwicklung und Nutzung einheitlicher Standards und Nomenklaturen, die Verbesserung der Interoperabilität technischer Komponenten und die sichere Vernetzung von IT-Systemen hoch relevante Daueraufgaben.
- Kompetenzausbau: TMA sollten in der Aus- und Weiterbildung sowie in Behandlungsleitlinien umfangreicher thematisiert werden. Für neue Berufsbilder (z. B. digitale MTA) sollten Aus- und Weiterbildungskonzepte entwickelt werden. Spezielle digitaltechnische Servicezentren könnten bei der Anwendung unterstützen. Für Patient/innen sollten zielgruppenspezifische Informations- und Unterstützungskonzepte entwickelt werden.
- In telemedizinischen Modellvorhaben sollten Ressourceneinsatz und Effizienzgewinne stärker in den Blick genommen werden. Dazu sollten Prüfverfahren weiterentwickelt sowie Evaluationsprozesse gestrafft und beschleunigt werden.
- Die angewandte Forschung zum Einsatz von Telekonsultationen sollte gefördert werden, um bei zunehmendem Fachkräftemangel eine wirksame, ressourceneffiziente Anwendung abzusichern. Zur Entlastung der Akut- und Notfallversorgung sollte ein 24/7-verfügbarer Telekonsultationsdienst auf- und ausgebaut werden. Dabei sollten die Erfolgsfaktoren des schweizerischen Teleklinikkonzepts berücksichtigt werden (strukturierte Ersteinschätzung, Guidelines zur Gesprächsführung, ein entsprechendes Informations- und Dokumentationssystem mit einem Qualitätsmonitoringkonzept sowie Schulung der Fachkräfte und Ärzt/innen in der Anwendung).
- Bei Telemonitoringkonzepten sollten Methodenbewertungen durch den G-BA auf notwendige Fälle beschränkt, die erforderlichen technische Elemente und Dienstleistungen zertifiziert und die Begleitforschung gestärkt werden, um die ersten regulär einsatzbereiten Konzepte praxisnah weiterzuentwickeln. Unterschiedliche Elemente von integrierter Versorgung durch spezialisierte Netzwerke über komplexes TMZ-realisiertes Telemonitoring bis hin zum weitgehenden Selbstmanagement der Vitaldatenüberwachung sowie die notwendigen Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren der einzelnen Komponenten sollten schrittweise zu einem Telemonitoringgesamtkonzept zusammengeführt werden, das auch auf weitere Anwendungskontexte übertragen werden kann.
- Telemedizinische Netzwerke dürften bestehende Versorgungsstrukturen perspektivisch am stärksten verändern. Sie sind ein Element der im Herbst 2024 beschlossenen Krankenhausreform sowie der geplanten Notfallreform, für die auch zukünftig vielfältige gesundheitspolitische Weichenstellungen erforderlich sein werden. Dazu müssen u. a. technische und personelle Anforderungen sowie rechtliche Zuständigkeiten definiert, die teilnehmenden Einrichtungen befähigt und Zertifizierungsverfahren entwickelt und eingesetzt werden. Die gemeinsame Datennutzung sollte befördert und eine dauerhafte Finanzierung der Netzwerkaktivitäten abgesichert werden. In einigen Netzwerken werden bereits seit Jahren Anwendungserfahrungen gesammelt. Diese Erfahrungen können wertvolle Hinweise zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim Ausbau sektorübergreifender medizinischer Versorgungsstrukturen liefern. Ein parlamentarisches Fachgespräch mit Netzwerkbetreibern und anderen relevanten Akteuren könnte ein geeignetes Forum bieten, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu identifizieren.
Downloads
|
TAB-Arbeitsbericht Nr. 215 Stand und Perspektiven der Telemedizin (PDF) Der TAB-Arbeitsbericht Nr. 215 bietet einen umfassenden Überblick über technische, medizinisch-administrative und rechtliche Aspekte telemedizinischer Ansätze sowie über den Stand der Anwendung. Bestehende Herausforderungen werden identifiziert sowie Forschungs- und Handlungsbedarfe aufgezeigt. Damit wird politischen Entscheidungsträgern fundiertes Orientierungswissen für zukünftige Weichenstellungen bereitgestellt. |
||
|
TAB-Fokus Nr. 49 Stand und Perspektiven der Telemedizin (PDF) Der TAB-Fokus bietet auf vier Seiten einen kompakten Überblick über Inhalt und Ergebnisse des TA-Projekts.
TAB-Fokus no. 49 Status quo and perspectives of telemedicine (PDF) The policy brief TAB-Fokus offers a compact overview of the content and results of our TA analyses on four pages. |
|
|
|
TAB-Sensor Nr. 4 (2022) Wie bewerten Bürger/innen die Telemedizin? Ergebnisse einer Repräsentativbefragung Der TAB-Sensor ergänzte das TA-Projekt. Er rückt die Sichtweise der Patient/innen bzw. Bürger/innen zu telemedizinischen Angeboten in den Mittelpunkt. Daneben fokussiert er auf den Einfluss der Telemedizin auf die Arzt-Patienten-Beziehung und auf Vor- und Nachteile von Videosprechstunden. |